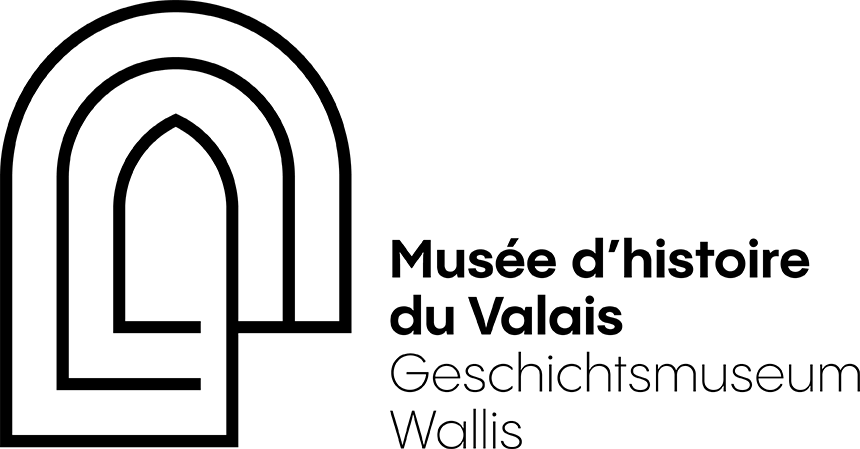Über uns
Das Museum heute
Das Geschichtsmuseum Wallis lädt Sie zu einer rund 50 000 Jahre umspannenden Zeitreise. Von den ältesten Spuren menschlicher Erzeugnisse, die von den Neandertalern hinterlassen wurden, zu den emblematischen Zeugnissen unserer Epoche kann man die vielfältige Vergangenheit des Gebiets des heutigen Wallis kennen lernen.
Eingebettet in den mittelalterlichen Burgflecken Valeria umfasst das Geschichtsmuseum Wallis die Burg Valeria sowie die ehemaligen Wohnhäuser der Chorherren, die ab dem 12. Jahrhundert hier ansässig waren. Diese im Verlauf der Zeit neu eingerichteten und gruppierten Häuser bilden heute ein Labyrinth von Räumen, in denen rund tausend Objekte aus den umfangreichen Sammlungen des Museums untergebracht sind. Diese zuweilen seltenen oder weltweit einzigartigen Zeugen des menschlichen Abenteuers erzählen die Geschichte eines homogenen, von den Gebirgsketten definierten Gebiets.
Der chronologisch organisierte Rundgang betont herausragende Thematiken der verschiedenen Epochen, von der Urgeschichte über die Bronzezeit, die Römerzeit und das Mittelalter bis heute. Von Raum zu Raum liefert diese Zeitreise den Besuchenden die Schlüssel zum Verständnis des heutigen Wallis.
Unsere Geschichte
Vor 1879: die Zeit der Pioniere
Als der Jesuitenpater Etienne Elaerts (1795–1853), Lehrer am Kollegium von Sitten, im Jahr 1829 die Neuorganisation des Physikkabinetts der Schule unternahm, fügte er eine naturhistorische Sammlung hinzu. Bald wollte er zudem einige «Antiquitäten» sammeln, die zu seinem Missfallen an Händler verhökert wurden. Der Kanton unterstützte alsbald dieses «kantonale Museum». Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erneut Stimmen gegen das Verschwinden des Walliser Erbes laut, denn einerseits wurden Objekte verkauft, anderseits Denkmäler zur Gewinnung von Baumaterial ausgeschlachtet. Mit dem Gesetz vom 31. Mai 1849 wurde die Kontrolle über das Museum und die Bibliothek des Kollegiums dem Kanton unterstellt, welcher den Unterhalt und die Weiterentwicklung übernahm.
1879–1882: die «archäologische Kommission»
Im Jahr 1879 wurde eine «archäologische Kommission» gebildet, die im Jahr 1881 vom Staatsrat amtlich anerkannt wurde. Es bestand das erklärte Ziel, ein Museum einzurichten, welches das bewegliche Kulturerbe des Kantons präsentieren sollte. Mit einem Rundschreiben wurde ab 1879 versucht, die Gemeinden und Kirchgemeinden für das Projekt zu sensibilisieren und dazu zu bewegen, Objekte aller Art für das Museum zu stiften. Vom bestehenden kantonalen Museum wurden die historischen Objekte ausgegliedert, zu denen die neuen Schenkungen hinzukamen, sowie die Waffen und Rüstungen, welche der Kriegskommissar Charles de Preux und der Konservator für Kriegsmaterial Eugène Theiler gesammelt hatten. Beide waren Mitglieder der Kommission, welche dem Departement für öffentliche Bildung angehörte. Weitere Mitglieder waren der Domherr und Historiker Pierre-Antoine Grenat, der als Präsident amtierte, Pierre-Marie de Riedmatten, Lehrer am Kollegium und Konservator des kantonalen Museums, sowie der Maler Raphael Ritz, ein eifriger Verfechter des Kulturerbes wie schon sein Vater Laurenz Justin Ritz.
1883: der erste Ausstellungsraum des Museums wird eröffnet
Dank der Vermittlung durch den Domherrn Pierre-Antoine Grenat erklärte sich das Domkapitel bereit, der Kommission einen der grossen Räume der Burganlage Valeria zur Verfügung zu stellen sowie einen Teil seiner Sammlungen. Nach einigen durch den Kanton ausgeführten Konsolidierungsarbeiten wurde im Jahr 1883 die erste Schau des «archäologischen Museums» eingeweiht. Das Wallis folgte damit im Fahrwasser der Einrichtung grosser patriotisch berufener Ausstellungshäuser, die im Jahr 1872 von Graubünden begonnen worden war, gefolgt von Luzern und Freiburg, 1873, und Bern, 1881. Das Landesmuseum Zürich hingegen öffnete seine Pforten erst 1898.
Die Sammlungen waren enzyklopädisch und gaben der Walliser Geschichte mit ihren bekannten Persönlichkeiten und Adelsfamilien den Vorzug. Die Weltgeschichte war aber auch vertreten, und archäologische Ausgrabungen wurden unternommen, insbesondere in Martinach, der ehemaligen römischen Provinzhauptstadt, um das Museum mit entsprechenden Objekten auszustatten. 1883 war das Jahr, als die berühmten grossen Bronzefiguren von Martinach entdeckt wurden.
1891: das Abkommen mit dem Domkapitel
Die Sammlungen nahmen rasch zu. Mit dem Domkapitel wurde ein Abkommen unterzeichnet – übrigens auf unbestimmte Zeit. So war sichergestellt, dass das Domkapitel dem Museum die meisten Zivilgebäude der Burganlage zur Verfügung stellte, unter der Bedingung, dass der Kanton diese restaurierte. Das Domkapitel verpflichtete sich zudem, die vorhandenen Kunstobjekte in der Kirche von Valeria zu belassen.
1893: die «kantonale Medaillensammlung» wird abgespaltet
Um auf Valeria Platz zu schaffen, wurde die kantonale Münzen- und Medaillensammlung vom archäologischen Museum getrennt und in einem Raum des Kollegiums untergebracht. Der Domherr Pierre-Antoine Grenat wurde der offizielle Konservator dieser Sammlung. Er kümmerte sich bereits seit 1891 um die numismatischen Sammlungen und überliess so Charles de Preux die Direktion des archäologischen Museums. Charles de Rivaz übernahm 1901 die Nachfolge von Domherr Pierre-Antoine Grenat als Konservator der Medaillensammlung, eine Aufgabe, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1914 erfüllte. Dann wurde die Funktion wieder vom Museumsdirektor übernommen.
1896: der Erlass zum «archäologischen und numismatischen Museum»
In einem Erlass vom 17. Juni 1896 definierte der Staatsrat die Funktionsweise des «archäologischen und numismatischen Museums». Die Institution wurde von der archäologischen Kommission überwacht, welche der Chef des Departements für öffentliche Bildung präsidierte. Die Kommission sorgte für die Erweiterung der Sammlungen, namentlich durch einen Kredit, der vom Grossen Rat gewährt wurde. Ausserdem wurden die Eintrittspreise festgelegt: 50 Rappen für Einzelpersonen, 1 Franken für Gruppen von 3 bis 6 Personen, 2 Franken für grössere Gruppen. Das Museum war am ersten Donnerstag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Ende des 19. Jahrhunderts: eine exponentielle Zunahme der Sammlungen
Die Jahresberichte erwähnen regelmässig, dass es an Platz fehlte, um die gesamten Sammlungen auszustellen. Zusätzlich zu den Objekten, welche die Kirchgemeinden sowie bestimmte Privatpersonen gestiftet hatten, gelangten grössere Objektegruppen ins archäologische Museum. Im Jahr 1890 hinterliess der Genfer Ernest Griolet, der oft im Val d’Anniviers Ferien machte, seine mehrere Hundert Münzen und Antiquitäten umfassende Sammlung dem Museum. Im Jahr 1896 vermachte Charles Fama, Direktor des Casinos von Saxon, dem Museum eine bedeutende, rund 5 000 Objekte umfassende Münzen- und Medaillensammlung mitsamt der dazugehörigen Bibliothek. Der Katalog, welchen das «kantonale archäologische Museum» im Jahr 1900 veröffentlichte, nannte 1 095 Objekte, ohne die numismatischen Sammlungen.
Beginn des 20. Jahrhunderts: eine Aufteilung in Geschichte und Archäologie
Die Restaurierung eines weiteren Gebäudes der Burganlage Valeria, das im Jahr 1904 eingeweiht wurde, ermöglichte es, die Präsentation der historischen Sammlungen und der archäologischen Objekte zu trennen. Im Januar desselben Jahres wurde in Savièse der Vorstand der Gesellschaft für Walliser Traditionen gebildet, die im Oktober 1903 gegründet worden war, mit der Absicht, Gegenstände des häuslichen Lebens zu sammeln, um das Museum mit diesem neuen Sammlungsbereich auszustatten. Präsident der Gesellschaft war Alphonse de Kalbermatten, der Architekt, welcher für die Bauarbeiten auf Valeria verantwortlich war, Vizepräsident war der Maler Raphy Dallèves und Sekretär der Maler Ernest Biéler. Als im Jahr 1905 der Direktor Charles de Preux verstarb, wurde die Interimsleitung von Henri de Preux übernommen, bis zur Nominierung des Architekts Joseph de Kalbermatten (1840–1920) im Jahr 1906 und, im Jahr 1908, dessen Sohnes Alphonse (1870–1960).
1906: das Gesetz über die Bewahrung von Kunstobjekten und historischen Denkmälern
Infolge des am 28. November 1906 erlassenen Gesetzes über die Bewahrung von Kunstobjekten und historischen Denkmälern wurde die archäologische Kommission aufgelöst und durch die «Kommission für historische Denkmäler» ersetzt, die ihren Tätigkeitsbereich zusätzlich auf das archäologische Museum und die kantonale Medaillensammlung ausweitete. Der Präsident dieser neuen Instanz war der Chef des Departements für öffentliche Bildung Joseph Burgener, als Vizepräsident amtierte Joseph de Kalbermatten (seine Nachfolge trat 1908 sein Sohn Alphonse an) und Sekretär war der Maler Joseph Morand. Im Jahr 1908 trat Alphonse de Kalbermatten an die Stelle seines Vaters Joseph. Während einer gewissen Zeit war er ausserdem Direktor des Museums, betreute die Restaurierung der Burganlage und präsidierte die Gesellschaft für Walliser Traditionen.
1913: ein neues Reglement
Im Januar 1913 wurde ein Spezialreglement erlassen für die Ortspolizei des Schlosses und des «historischen Museums Valeria». Dieser Text regelte die Pflichten des Aufsichtspersonals, die Öffnungszeiten usw.
1917: die Stelle des Kantonsarchäologen wird geschaffen
Auf Anstoss von Joseph Morand wurde im Jahr 1917 die Stelle eines Kantonsarchäologen geschaffen, wodurch die Kommission für historische Denkmäler in eine beratende Funktion zurückgestuft wurde. Joseph Morand wurde für diese Stelle nominiert, welche ausserdem die Aufgaben des Konservators des Geschichtsmuseums und der Medaillensammlung beinhaltete. Ein weiteres Gebäude wurde auf Valeria restauriert und dem Museum zugewiesen, vielleicht für die Objekte der Gesellschaft für Walliser Traditionen – die diesbezüglichen Informationen im Archiv sind nicht sehr ausführlich.
1932–1935: Stellenabbau
Joseph Morand starb im Jahr 1932. Pierre Courthion, Kunstkritiker und Direktor des Schweizer Hauses der Cité universitaire von Paris, trat seine Nachfolge an, aber nur in Teilzeit, für 2 Monate pro Jahr. Im Jahr 1935 wurde die Stelle schliesslich aus Kostengründen mit jener des Kantonsarchivars fusioniert, damals André Donnet. Während dieser mageren Jahre konnte die Sammlungsarbeit nicht optimal fortgeführt werden, und insbesondere die Inventare wurden dadurch in starke Mitleidenschaft gezogen.
Die 1940er-Jahre: ein neuer Aufwind
Nach dem Krieg erfolgte eine Neuorganisierung der kulturellen Dienststellen, mit der Zuteilung neuer Mittel. Der Archäologe Pierre Bouffard wurde um 1945 damit beauftragt, die archäologischen Sammlungen der allgemein als «Museum von Valeria» bezeichneten Institution neu zu organisieren. Im Jahr 1944 wurde der Maler Albert de Wolff als Konservator des Museums nominiert, mit der spezifischen Aufgabe, auf Schloss Majoria ein Kunstmuseum zu schaffen. Er arbeitete erst in Teilzeit, da er zugleich als Adjunkt des Kantonsarchivars tätig war, später bestritt er zusätzlich ein Pensum als Zeichenlehrer am Kollegium, bis er sich schliesslich vollständig den Museen widmen konnte. Für die neu zu schaffende Institution entnahm Wolff aus den Beständen des «Museums von Valeria» die Kunstwerke, die er für den Aufbau einer repräsentativen Sammlung benötigte. Das Kunstmuseum wurde 1947 eingeweiht.
1963: ein neues Gebäude für die ethnografischen Sammlungen
Nach einer mehrmals aufgeschobenen tiefgreifenden Restaurierung konnte auf Valeria ein weiteres Gebäude eröffnet werden, im Umfeld des Caminata-Saals. Dies war die Gelegenheit für de Wolff, dort die regionalen ethnografischen Sammlungen zu präsentieren, deren Aufbau sich in der Nachkriegszeit professionalisiert hatte. Die neue, bereinigte Präsentation, nach Disziplin statt chronologisch geordnet, brach mit der früheren, enzyklopädischen Ausstellungsgestaltung.
1970er-Jahre: die Schaffung neuer Museen
De Wolff nutzte die ihm gebotenen Gelegenheiten, um neue Museen zu schaffen. Der Staatsrat beauftragte ihm damit, im Schloss Saint-Maurice, für das man einen Nutzungszweck suchte, ein kantonales Militärmuseum einzurichten. Im Jahr 1974 war es so weit. Und schon im Jahr 1976, infolge bedeutender Entdeckungen am Ort Petit-Chasseur – darunter die berühmten anthropomorphen neolithischen Stelen – und aufgrund der Schenkung einer Antiquitätensammlung aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten durch den Sammler Edouard Guigoz, wurde in den Räumen der Grange-à-l’Evêque ein Archäologiemuseum eröffnet. Im folgenden Jahr wurde das gallorömische Museum von Octodurus, eine Zweigstelle des Archäologiemuseums, in der Fondation Pierre Gianadda, in Martinach, untergebracht. Jedes Mal wurden aus den Beständen des «Museums von Valeria» die notwendigen Objekte für die neuen Institutionen entnommen. Als Albert de Wolff im Januar 1978 einem Unfall erlag, brach dieser Elan ab.
1978–1984: Wiederaufnahme der Grundlagenarbeit
Während ihres Interimsmandats von 1978 bis 1984 unternahm die Ethnologin Rose-Claire Schüle besondere Anstrengungen, die mühevolle Kontrolle und Inventarisierung der Bestände auszuführen. Parallel dazu förderte sie eine auf Zusammenarbeit basierende Vision, insbesondere durch die Gründung der Vereinigung der Walliser Museen im Jahr 1981.
1984–2004: Professionalisierung
Sobald sie im April 1984 die Direktion der Walliser Kantonsmuseen übernahm, änderte die Kunsthistorikerin Marie Claude Morand den Namen der Institution in «kantonales Museum für Geschichte und Ethnologie», wodurch das Zeitgenössische deutlich aufgewertet wurde. Im Folgejahr wurde ein Abkommen zwischen dem Kanton und dem Domkapitel unterzeichnet, welches dem Museum die Garantie gab, für ein weiteres halbes Jahrhundert in der Burganlage Valeria verbleiben zu können. Hingegen musste die etwas in die Jahre gekommene Dauerausstellung neugestaltet werden. Neben der Professionalisierung des Personals, der Nominierung mehrerer Wissenschaftler sowie Kampagnen zur Konservierung der Sammlungen begann damals eine langfristige Überlegung zur Neustrukturierung des Museums. Im Jahr 2005 unterbreitete Marie Claude Morand dem Staatsrat den Vorschlag, die Funktionen der Generaldirektion und des Konservators des Museums für Geschichte und Ethnologie voneinander zu trennen. Darauf wurde Patrick Elsig als Konservator des Museums nominiert (im Jahr 2010 wurde die Stelle des Konservators in jene des Museumsdirektors umgewandelt).
2004–2009: die Neugruppierung der Sammlungen
Da sie den Personalbestand nicht genügend erhöhen konnte, sah sich Marie Claude Morand gezwungen, die Institutionen neu zu gruppieren und von sechs auf drei zu reduzieren (Kunst, Geschichte, Natur). Die Sammlungen des numismatischen Kabinetts (so hiess die kantonale Medaillensammlung seit 1989), des Militärmuseums und des Archäologiemuseums wurden im Geschichtsmuseum gruppiert, von dem sie ja ursprünglich auch stammten. Das zu wenig besuchte Militärmuseum wurde 2004 geschlossen, und im Jahr 2009 wurde das Archäologiemuseum, nach einer letzten Sonderausstellung, ebenfalls geschlossen.
2008: die neue Präsentation des Geschichtsmuseums Wallis
Nachdem zwei provisorische Inszenierungen einen Vorgeschmack auf das Bevorstehende gegeben hatten – die Ausstellung wurde jeweils in einem Teil der Gebäude auf Valeria untergebracht, während der andere restauriert wurde –, konnte am 12. September 2008 die neue Dauerausstellung in den technisch vollständig neu ausgestatteten Gebäuden und mit einer neuen Museografie eingeweiht werden. Die seit 1998 «kantonales Geschichtsmuseum» genannte Institution trägt seit 2007 den Namen «Geschichtsmuseum Wallis». Die neue Dauerausstellung bietet einen chronologischen Rundgang, wobei jeder einzelne Raum einem herausragenden Thema gewidmet ist. Die Ausstellung versteht sich als vollständiges Panorama der Walliser Geschichte und räumt der Archäologie einen wichtigen Platz ein, als Ausgleich zur Schliessung des Archäologiemuseums.
2015: der Kirchenschatz
Um die Kunstobjekte, die nicht in der Basilika von Valeria verbleiben konnten, angemessen zu schützen, wurde im früheren Archivraum, der westlich an der Kirche anliegt, ein eigener Ausstellungsraum eingerichtet, der im Jahr 2015 eingeweiht werden konnte. Alle hier gezeigten Objekte, die eine breite Palette von Techniken umfassen, stammen von Valeria und erinnern an die über tausendjährige Präsenz des Domkapitels an diesem Ort.
Unser Team
Patrick ELSIG – Direktor des Geschichtsmuseums –
Ursina BALMER – Kulturvermittlung Deutsch und Französisch –
Diony BETRISEY – Leitung Empfang –
Charlotte BLASI – Kulturvermittlung –
Sophie BROCCARD – Inventar Abteilung Ur- und Frühgeschichte –
Camille FONTAN – Konservatorin für die Abteilung Neuzeit und Zeitgeschichte –
Jeannine GARAUDEL – Kulturvermittlung Deutsch und Französisch –
Valentine GIESSER – Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Mittelalter –
Mélanie MARIÉTHOZ – Sekretariat-Assistenz –
Pierre-Yves NICOD – Konservator der Abteilung Ur- und Frühgeschichte –
Partnerschaften
Das Geschichtsmuseum Wallis dankt all seinen kulturellen wie finanziellen, vergangenen wie gegenwärtigen Partnerinnen und Partnern für ihre Zusammenarbeit und ihre grosszügige Unterstützung.
Freundinnen und Freunde
Freunde und Freundinnen von Valeria
Die 1996 gegründete Gesellschaft hat das Ziel, die Forschung zu fördern sowie das Wissen über den Burgflecken Valeria und die hier konservierten Sammlungen zu verbreiten und zu vertiefen. Der Verein unterstützt deshalb sehr unterschiedliche Aktivitäten, wie die Finanzierung von Restaurierungen oder Ankäufe für das Geschichtsmuseum Wallis, Forschungsarbeiten, Vorträge oder die Herausgabe von Publikationen.
Die Mitglieder werden regelmässig zu Führungen und Reisen im Zusammenhang mit Valeria eingeladen oder zu Veranstaltungen vor Ort, wie Sonntagsmessen, Frühlingsputz auf dem Burghügel. Im Vorstand sind das Domkapitel von Sitten, die Eigentümer des Orts, das Geschichtsmuseum Wallis, welches hier seine Dauerausstellung zeigt, sowie die Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe, die für Restaurierung und Unterhalt verantwortlich ist, vertreten.
Mehr erfahren oder Mitglied werden: Freundinnen und Freude von Valeria
Unterstützung und Partnerschaften
Fachverbände
Das Geschichtsmuseum Wallis ist Mitglied der folgenden Fachverbände:
- VWM – Vereinigung der Walliser Museen
- ICOM Schweiz – Internationaler Museumsrat
- VMS/AMS – Verband der Museen der Schweiz
- Verband Die Schweizer Schlösser
- Netzwerk Mittelalterliche Kunst in den Alpen
Kulturelle Partnerschaften
- Domkapitel Sitten
- Internationales Festival der Orgel von Valeria